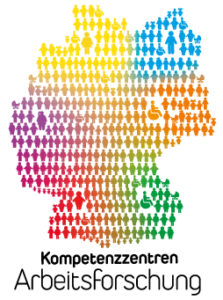Woher kommen eigentlich all die Operationsbestecke, Implantate und Modelle in Arztpraxen und Krankenhäusern? Meistens nicht aus dem 3D-Drucker. Zumindest noch nicht. Robert Möbius versucht, das zu ändern.
Dafür betreut der Laboringenieur beim Branchencluster für Biotechnologie und Medizintechnik in Sachsen u.a. das Team NEXT3D. Die Arbeitsgruppe hat in den vergangenen Jahren am Universitätsklinikum Leipzig verschiedene 3D-Druck Lösungen bis zur Zertifizierung nach Medizinproduktenorm ISO 13485 gebracht. Das bedeutet, die 3D-Druck-Erzeugnisse sind als patientenindividuelle Sonderanfertigungen zugelassen für den medizinischen Einsatz am Patienten, etwa zur sicheren Navigation während eines gefäßchirurgischen Eingriffs oder einer OP im Gehirn.
Aus Sicht von Robert Möbius könne die sich rasant weiterentwickelnde 3D-Druck-Technologie schon heute viel flächendeckender und effektiver in der Patientenversorgung eingesetzt werden. Zu den Vorteilen der Technologie gehört, dass sich im Vergleich zu anderen Herstellungsverfahren sehr schnell und kosteneffizient maßgeschneiderte Komponenten für Instrumente, Implantate und ähnliches anfertigen lassen. Sowohl Zeit als auch Präzision sind in der Medizin wichtige Parameter für den Behandlungserfolg, die auch dem behandelnden Personal die Arbeit erleichtert und sicherer gestaltet.

Ein Nachteil ist, dass es bislang nur eine geringe Auswahl an zertifizierten Materialien (Kunststoffen oder Metalle) und 3D-Druck-Prozessen gibt, die den hohen Anforderungen in der Medizin wie biologischer Verträglichkeit und Sterilisierbarkeit entsprechen. Wesentliche Hürden lägen derzeit noch im zögernden Gesundheitswesen und bei den Anwendern selbst, erklärt Robert Möbius:
„Zu den Gründen für die geringe Auswahl gehören fehlende und teils uneinheitliche Prüfnormen, aufwendige Zulassungsprozesse und ein Mangel an klinischen Daten.“
Robert Möbius Tweet
Dazu komme, dass ärztlichem Fachpersonal oft das Wissen über die Technologie fehle, sagt der Ingenieur. Entsprechend hoch sei die Hürde, sie im Klinikalltag zu nutzen.
Das ist ein Punkt, an dem die Semper-KI 3D-Druck Plattform ansetzt. Angelegt ist die Plattform für Nutzende jedes Wissensstandes. Sie werden von einem KI-Assistenzsystem durch die Plattform geführt. Dabei fragt die Assistenz strukturiert und automatisiert die für den Druck relevanten Informationen ab. Bei sehr spezifischen Anwendungsfeldern wie der Medizin kommt zum Tragen, dass die Assistenz auch den Kontext berücksichtigt, indem das Bauteil eingesetzt wird – etwa Umgebung, einwirkende Kräfte oder Langlebigkeit.

Robert Möbius hat dafür ein Beispiel aus den bisherigen Zertifizierungsprozessen: „Medizinprodukte sind üblicherweise so blütenweiß wie die Kittel ihrer Anwender. 3D-Druck-Materialien sind ursprünglich aber meistens für Maschinen- und Werkzeugbau entwickelt.“ Dadurch seien sie in der Regel grau oder trüb gefärbt. Die Farbe habe zwar keinen Einfluss auf medizinisch relevante Parameter wie Funktionalität oder Sterilität. Aber “sie beeinflusst maßgeblich, ob die Produkte als für die Medizin geeignet angesehen werden oder nicht”, sagt der Ingenieur. Problematisch für den medizinischen Einsatz seien dagegen vielmehr nachträgliche Oberflächenveredelungen wie chemisches Glätten oder Färben, um die Produkte optisch ansprechender erscheinen zu lassen.
Solche Aspekte können auf der Semper-KI 3D-Druck-Plattform nicht nur von Anfang an berücksichtigt, sondern jederzeit auch an neue Hersteller weitergegeben werden. So wird die Kommunikation für beide Seiten, Hersteller und Auftraggeberin, nachvollzieh- und dokumentierbar. Das spart im Vergleich zur manuellen Suche erheblich Zeit und Mühe.
Indem 3D-Druck durch die Plattform besser zugänglich ist, könnte sich das Herstellungsverfahren auch in der Medizin in Zukunft weiterverbreiten. Das würde ein weiteres Problem lösen, mit dem Robert Möbius oft konfrontiert ist: Die Kosten. Auch sie gehören zu den Gründen, warum die wenigen zugelassenen Materialien kaum in den praktischen Klinik- und Praxisalltag überführt sind. Diese müssen Patientinnen und Patienten in der Regel selbst tragen. Weitere Behandlungserfolge könnten aber die Notwendigkeit erhöhen, dass Krankenkassen und Kliniken die Kosten erstattungsfähig machen, erklärt Robert Möbius: „Entwicklungs- und Zulassungskosten müssen sich für den Hersteller natürlich auch im Preis widerspiegeln.“
Langfristig könnten sie dann aber zu Kostensenkungen im Gesundheitssystem führen.
Und damit eine patientenspezifische Versorgung zum Standard werden lassen. Um dieses Thema auch zukünftig voranzutreiben, sucht die biosaxony nach weiteren interessierten Kooperationspartnern wie Ärzten, Kliniken, Krankenkassen oder Industrievertretern.