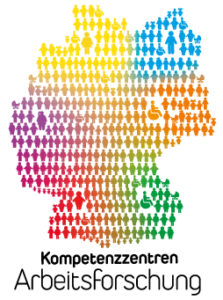Was ist digitale Transformation?
Der Begriff der digitalen Transformation geistert bereits seit Jahrzehnten als Schlagwort herum und wird mal als Schreckgespenst, mal als Vision, inzwischen vor allem aber als Arbeitsauftrag verstanden. Wissenschaftlich betrachtet steht digitale Transformation für einen durch digitale Technologien angetriebenen Veränderungsprozess in Organisationen. Dieser Prozess betrifft nicht nur organisationsinterne Prozesse wie die Auswahl und Gestaltung von Kommunikationskanälen oder isolierte Arbeitsabläufe, sondern wirkt sich zumeist auch auf das komplexe Ökosystem von Unternehmen bzw. Organisationen, also auf die Arbeit mit der Zielgruppe, mit Partnern, mit potenziellen Bewerber:innen etc., aus (Riasanow et al. 2022, Vial 2019). Begrifflich sind somit digitale Transformation und Digitalisierung, als bloße Einführung digitaler Technologien und Softwarelösungen, welche ein fester Bestandteil digitaler Transformation ist, voneinander zu unterscheiden.
Digitale Transformation stellt eine besondere Form von Organisationsentwicklung dar (Riasanow et al. 2022) und bedarf einer Strategie (Matt et al. 2015), um im Sinne einer Menschzentrierung negative Effekte wie Überforderung mit der neuen Technologie oder neuen Prozessen bzw. Unzufriedenheit zu vermeiden. Menschzentrierung beginnt bei der Erhebung von Bedarfen, um abzuklären, ob Digitalisierung überhaupt der richtige Lösungsansatz für ein bestehendes Problem ist, beinhaltet aber auch das Erfassen von Anforderungen an die Technologie und reicht bis zur Evaluation des Einführungsprozesses und Nutzens digitaler Lösungen.
Wieso ist digitale Transformation ein Thema für Non-Profit-Organisationen?
Während Branchen, wie das produzierende Gewerbe, bereits viel Erfahrung mit Digitalisierungsprozessen haben und für die digitale Transformation ein fester Bestandteil der Unternehmensentwicklung ist, stehen viele Non-Profit-Organisationen (NPO) noch relativ am Anfang ihrer digitalen Transformation. Die Covid-19 Pandemie hat viele Digitalisierungsprozesse angestoßen, eine strategische Planung bzw. ein Managementprozess, der einer klaren Vision von Organisationsentwicklung folgt, ist in einer Krisensituation, in der es vor allem darum ging, die eigene Arbeitsfähigkeit zu erhalten, nicht möglich gewesen. Auch wenn eine grundlegende digitale Infrastruktur inzwischen auch in NPO zum Arbeitsalltag gehört (Vgl. Stubbe et al. 2025) und gesetzliche Vorgaben zur Digitalisierung, etwa zur Arbeitszeiterfassung oder zukünftig die digitale Personalakte, umgesetzt werden, bleibt die Ausgestaltung der digitalen Transformation der eigenen Organisation ein häufig vernachlässigtes Thema.
Begrenzte finanzielle Mittel für digitale Ausstattung (Hardware und Software), steigende gesellschaftliche Erwartungen hinsichtlich digitaler Kommunikation (Social Media Präsenz, Websites, digitale Kommunikationskanäle) und die wachsende Komplexität von Technologien, die durch KI noch einmal eine deutliche Steigerung erfahren hat – dies alles sind Gründe, die NPO zögern lassen, das Thema anzugehen. Um sich in einer zunehmend digitalen Welt auch weiterhin behaupten zu können und gleichzeitig ihre sozialen oder gesellschaftlichen Ziele effektiv zu verfolgen, müssen NPO die Potenziale einer digital-getriebenen Organisationsentwicklung angehen.
Was bedeutet das konkret für NPO?
Die digitale Transformation ist kein Projekt mit Anfang und Ende, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Dabei sind die nachfolgend skizzierten Aspekte zentrale Erfolgsfaktoren:
Strategisches Umdenken: Digitalisierung darf kein Randthema sein, sondern sollte ein integraler Bestandteil der Organisationsstrategie werden – mit klaren Zielen und vor allem Verantwortlichkeiten. Dies bedeutet auch, dass konkrete Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen. Diese Ressourcenbedarfe umfassen sowohl die personelle Ausstattung von Digitalisierungsvorhaben, also Verantwortliche, die für die Auswahl, Einführung und Begleitung von Digitalisierungsvorhaben zuständig sind, als auch Zeit für Weiterbildung von Beschäftigten zum Aufbau allgemeiner oder toolbasierter digitaler Kompetenzen und Datenkompetenzen, sowie finanzielle Mittel für Hardware-Ausstattung und Software.
Leitfragen für NPO:
- Wer ist verantwortlich für die Planung und Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen?
- Hat unsere Organisation eine Digitalisierungsstrategie?
- Was brauchen unsere Mitarbeitenden, um mit neuer Technologie arbeiten zu können?
- Haben alle Beschäftigten Zugang zur notwendigen technischen Ausstattung, um digital arbeiten zu können?
- Verfügen alle über die notwendigen Kompetenzen, um die Technologie zu nutzen, potenzielle Risiken zu erkennen und digitale Arbeitsprozesse umzusetzen?
- Wird den Mitarbeitenden ausreichend Zeit eingeräumt, um Anforderungen an Technologie zu formulieren, sich in neue Arbeitsprozesse einzuarbeiten und im Sinne einer Evaluation Feedback zu geben?
Offenheit für Veränderung: Nicht jede digitale Lösung passt zu jeder Organisation. Eine innovationsförderliche Organisationskultur, die offen für Impulse aus dem Kollegium ist, ermöglicht eine bedarfsgerechte und nachhaltige Transformation. Dabei ist es wichtig, auch Fehler aushalten zu können und sie als Lernchancen zu begreifen.
Leitfragen für NPO:
- Findet eine Reflexion von Digitalisierungsprozessen statt?
- Wie wird sichergestellt, dass verschiedene Perspektiven auf Digitalisierungsprozesse (Was lief gut? Was lief weniger gut?) berücksichtigt werden?
- Gibt es Möglichkeiten für Mitarbeitende, innovative Ideen im Kontext der Digitalisierung einzubringen?
Netzwerke und Unterstützungsformate nutzen: Oft fehlen NPO die Ressourcen für große Digitalprojekte oder die Expertise, um Risiken, wie das Reproduzieren von Bias oder die Intransparenz im Hinblick auf die Einhaltung von Datenschutz-Regelungen, die etwa mit komplexen KI-Technologien einhergehen, einschätzen zu können. Netzwerke wie das NPO-Cluster von ROOTS können helfen, Wissen und Erfahrungen auszutauschen und aus dem gemeinsamen Erfahrungsfundus zu lernen.
Leitfragen für NPO:
- Nutzen wir Netzwerke, um uns über Trends zu informieren oder Erfahrungen mit Digitalisierungsprozessen zu konkreten Technologien oder strategischen Themen wie der Entwicklung von KI-Strategien auszutauschen?
- Gibt es ggf. branchenspezifische Austauschformate, die wir nutzen können?
Wertorientierung: Digitale Transformation sollte sich immer an den Bedürfnissen der Nutzenden orientieren. Dies können die Beschäftigten selbst sein, aber auch die Zielgruppe der NPO-Arbeit. Für beide Gruppen spielen die Werte, die ein zentraler Bestandteil des Selbstverständnisses von NPO sind, die Grundlage für ihr gemeinwohlorientiertes Handeln bilden und die häufig in Dokumenten wie Leitbildern oder Vereinssatzungen manifestiert sind (beispielsweise Gerechtigkeit, Transparenz, Vielfalt oder Antidiskriminierung), eine zentrale Rolle. Um Konflikte zu vermeiden und Vertrauen in die Organisation zu erhalten, sollte Wertorientierung ein fester Baustein digitaler Transformation von NPO sein. Im Punkt der Technologieauswahl kann sich dies etwa in Fragen nach der Barrierefreiheit des Softwaredesigns oder des Datenschutzes widerspiegeln. Auch der Einführungsprozess von Software sollte menschzentriert gestaltet werden und Aspekte wie unterschiedliche Kompetenzstufen und sich daraus ableitende Zeit- und Schulungsbedarfe einbeziehen. Im Teilvorhaben ROOTS erforschen wir, wie dies gelingen kann, welche Methoden sich eignen, um wertorientierte digitale Transformation zu unterstützen und welche Rolle Partizipation in diesem Kontext spielen kann.
Leitfragen für NPO:
- Wie beziehen wir unsere Beschäftigten in die Planung von Digitalisierungsvorhaben mit ein?
- Spiegeln sich die Werte, für die wir mit unserer Arbeit stehen, auch in der Digital- bzw. KI-Strategie unserer Organisation wider?
- Sind wir uns über ethische Aspekte, und konkrete soziale und ökologische Risiken, die sich im Kontext von KI ergeben, bewusst und berücksichtigen wir diese in unseren Digitalisierungsentscheidungen?
Im Rahmen von ROOTS unterstützt das Kompetenzzentrum KMI Organisationen bei der Gestaltung ihrer digitalen und zugleich werteorientierten Transformation. Sollten Sie Interesse an einer individuellen Beratung oder wissenschaftlichen Begleitung Ihres Transformationsprozesses haben, melden Sie sich gerne bei uns. Die WissenschaftlerInnen des KMI bieten vielfältige Workshops, sind aber auch immer offen für Projektideen und auf der Suche nach interessierten Praxispartnern für die anwendungsorientierte Forschung.
Autorin: Julia Friedrich
Literatur
Matt, C., Hess, T., and Benlian, A. (2015). Digital transformation strategies. Business & Information Systems Engineering (57:5), pp. 339-343.
Riasanow, T., Soto Setzke, D., Böhm, M., Krcmar, H. (2022). Der Begriff der digitalen Transformation: Ein transdisziplinärer Literaturüberblick. In: Oswald, G., Saueressig, T., Krcmar, H. (eds) Digitale Transformation. Informationsmanagement und digitale Transformation. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37571-3_4
Stubbe, J., Krieger, B., Damschke, N. (2025). Gemeinwohlorientierte KI: Ist die Zivilgesellschaft „AI ready“? Kurzstudie im Rahmen der Initiative „Civic Coding ‒ Innovationsnetz KI für das Gemeinwohl“. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) (Hrsg.). Online verfügbar unter: https://www.civic-coding.de/fileadmin/civic-ai/Dateien/20250416-CC-Kurzstudie_UA.pdf
Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems, Volume 28, Issue 2, pp. 118-144. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003