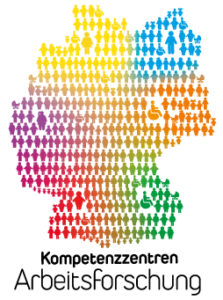Empowert – wofür? Aktuelle Herausforderungen für NPO
Was brauchen Nonprofit-Organisationen (NPO), um sich für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu wappnen? Digitales Empowerment könnte darauf eine Antwort sein, wenn darin sowohl die vielschichtigen Herausforderungen als auch die spezifische Ausgangslage von NPO in Betracht genommen werden. In diesem Sinne verstanden ist Empowerment die Befähigung, sich den aktuellen Problemlagen zu stellen und mit den sich bietenden Möglichkeiten neue kreative Lösungen für die Gestaltung von NPO zu finden.
Finanzkrisen und damit einhergehende Kürzungen öffentlicher Gelder, politische Angriffe auf lokaler und parlamentarischer Ebene und eine zunehmende Vereinzelung in der Gesellschaft sind nur einige der multiplen Krisen, die sich seit der Jahrtausendwende zuspitzen. Für NPO werden die Konsequenzen dieser Krisen unter dem Begriff der shrinking spaces (dt.: schrumpfender Raum) zusammengefasst (CIVICUS 2018): Der weltweit immer kleiner werdende Aktionsradius, der Autonomie und Gestaltungsfreiheit zivilgesellschaftlicher und Nonprofit-Organisationen beschränkt, verursacht z.B. durch finanzielle Kürzungen, politischen Druck und hohe Konkurrenz, u.a. durch profitorientierte Unternehmen. Es sind aber gerade diese (schwindenden) Gestaltungsräume, die es NPO ermöglichen, als Akteure für das Gemeinwohl zu handeln und ihre Rolle als Innovationsmotor einer lebendigen Zivilgesellschaft erfüllen zu können (Maier et al. 2009). Oft führen shrinking spaces dazu, dass NPO ihre Prozesse und Organisationsstrukturen „Managerialisieren“ (ebd.): Die Gestaltung von effizienteren und effektiveren Prozessen, oftmals durch und mit digitalen Tools, um das Überleben der Organisation und das Erreichen der Organisationsziele zu sichern (Simić Žana et al. 2014). Vor allem KI-Tools versprechen nie dagewesene Möglichkeiten der Arbeitserleichterung für die NPO-Arbeit, wie bspw. leicht zugängliche und kostenlose Generierung von Texten für die Öffentlichkeitsarbeit. Diese Entwicklung wird jedoch kontrovers diskutiert und auch NPO stellen sich die Frage:
Wie können wir digitale Tools und KI vor dem oben beschriebenen Hintergrund so einsetzen, dass die digitalen Möglichkeiten ausgeschöpft werden und wir gleichzeitig unseren Eigenansprüchen, Werten und Mission als gemeinwohlorientierte Organisation treu bleiben?

Foto von Maria Thalassinou auf Unsplash
Entwicklungsbedarfe
Auch wenn viele NPO und Ratgeberliteratur die Potenziale digitaler Lösungen herausstellen, herrschen noch große Unsicherheiten: Eine in ROOTS durchgeführte Studie zeigt für den Raum Leipzig, dass fast die Hälfte der befragten Organisationen nicht einschätzen können, wie sich KI auf die Arbeit in der Organisation auswirken könnte – insgesamt ein Viertel befürchten negative Konsequenzen. Dies wird auch von der ZiviZ Studie aus 2023 gestützt, in der das Stimmungsbild von NPO gegenüber Digitalisierung eher verhalten ist. Einige Organisationen beklagen sogar, dass durch digitales Arbeiten das Gemeinschaftsgefühl beeinträchtigt wird (Schubert et al. 2023). Um diesen Unsicherheiten zu begegnen, ist eine strategische Kompetenzentwicklung erforderlich. Auch NPO erkennen die Bedeutung digitaler und KI-bezogener Kompetenzen (Dufft und Kreutter 2018). Deren Vermittlung sollte idealerweise Teil einer ganzheitlichen Organisationsentwicklung sein (Schubert et al. 2023) . Digitale Kompetenzen dürfen dabei nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen in ein Befähigungskonzept eingebettet sein, das die Organisation umfassend in den Blick nimmt.
Insbesondere aufgrund der komplexen Herausforderungen für NPO muss eine Organisationsentwicklung stets die verschiedenen Gestaltungsbereiche, wie z.B. die Organisationswerte, die Kommunikation oder die digitalen Strategien, analysieren und berücksichtigen, wie diese sich wechselseitig beeinflussen (Peters et al. 2024). Auch im Zusammenhang mit organisationaler Resilienz, vor allem im Hinblick auf aktuelle und kommende Krisen, zeigt sich die Relevanz umfassender Unterstützungsansätze. Nur in wenigen Organisationen stehen dafür ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung, weshalb vor allem kostengünstige und leicht zugängliche Formate sowie der Austausch mit anderen Organisationen als gewinnbringend betrachtet werden (ebd.).
Damit NPO durch diese vielschichtigen Herausforderungen und Unsicherheiten navigieren können, arbeiten wir im ROOTS Projekt an Hilfestellungen für NPO, die diese Komplexität berücksichtigen und eine zukunftsgerichtete, digitale und wertorientierte Organisationsentwicklung ermöglichen. Diese werden in ein Befähigungskonzept eingegliedert, in welchem das Empowerment von NPO nicht nur organisationsspezifische Relevanz hat, sondern in seinem gesellschaftlichen Mehrwert für das Gemeinwohl verstanden wird.
ROOTS Befähigungskonzept
Betrachtet man NPO in ihrer Rolle als „demokratische Bildungsräume“ (Priller und Zimmer 2000), lassen sich für ein solches ganzheitliches Empowerment-Konzept vier Kompetenzbereiche festlegen (nach Massing (2012)):
- Fachwissen
- Urteilsfähigkeit
- Handlungsfähigkeit
- Methodische Fähigkeiten
Das Befähigungskonzept, das im Projekt ROOTS entwickelt wird und spätestens im letzten Quartal 2025 als Webseite veröffentlicht werden soll, baut auf diesen vier zentralen Kompetenzbereichen auf. In ihnen werden die Themen Werteorientierung, Digitalisierung und Partizipation ausgearbeitet – als Teil einer strategischen Organisationsentwicklung für Non-Profit-Organisationen (Friedrich et al. 2024). Daraus ergibt sich für die Ausgestaltung des Befähigungskonzeptes folgender Aufbau:
Kompetenzbereiche | Befähigungskonzept ROOTS für NPO |
Fachwissen | Themenseiten |
Urteilsfähigkeit | Themenseiten; Self-Assessment; Entscheidungshilfen |
Handlungsfähigkeit | Vorgehensmodell, Best-Practice Beispiele, Vernetzungsangebote |
Methodische Fähigkeiten | Methodensammlung; Workshop-Angebote |
Nicht zuletzt ist es wichtig herauszustellen, dass auch der digitale Raum durch NPO gestaltbar ist und aktuelle Gestaltungshoheiten und Machtverhältnisse hinterfragt werden können und müssen. So werden neue digitale Narrative ermöglicht, die Organisationen nicht nur dazu befähigen, globale und soziale Kontexte der digitalen Welt zu verstehen (d.h. zukunftsfähig zu werden), sondern diese aktiv und kreativ nach den eigenen gemeinwohlorientierten Werten zu gestalten (d.h. zukunftsgestaltend zu werden).
Autorin: Vanita Römer
Literatur
CIVICUS (2018): CIVICUS Monitor Methodology Paper.
Dufft, Nicole; Kreutter, Peter (2018): Digitalisierung in Non-Profit-Organisationen: Strategie, Kultur und Kompetenzen im digitalen Wandel. In: Reinhard Berndt, Peter Kreutter und Stefan Stolte (Hg.): Zukunftsorientiertes Stiftungsmanagement. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 105–115.
Friedrich, Julia; Römer, Vanita; Zinke-Wehlmann, Christian (2024): Participation as Fuel for Transformation – An Approach to the Interrelations Between Digitalization, Participation and Values in NPOs. In: Luis M. Camarinha-Matos, Angel Ortiz, Xavier Boucher und Anne-Marie Barthe-Delanoë (Hg.): Navigating Unpredictability: Collaborative Networks in Non-linear Worlds, Bd. 726. Cham: Springer Nature Switzerland (IFIP Advances in Information and Communication Technology), S. 351–364.
Maier, Florentine; Leitner, Johannes; Meyer, Michael; Millner, Reinhard (2009): Managerialismus in Nonprofit Organisationen. In: Kurswechsel 4, S. 94–101.
Massing, Peter (2012): Die vier Dimensionen der Politikkompetenz. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (46-47). Online verfügbar unter https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/148216/die-vier-dimensionen-der-politikkompetenz, zuletzt geprüft am 10.07.2025.
Peters, Stephan; Kny, Josefa; Scheffel, Franka; Ullrich, Angela (2024): Nicht kleinzukrisen. Was die Zivilgesellschaft resilient macht. Hg. v. betterplace lab. Berlin. Online verfügbar unter https://storage.googleapis.com/lab-website-2019-assets/betterplace-lab-Nicht-kleinzukrisen.-Was-die-Zivilgesellschaft-resilient-macht-2024.pdf, zuletzt geprüft am 10.07.2025.
Priller, Eckhard; Zimmer, Annette (2000): Der Dritte Sektor in Deutschland – seine Perspektiven im neuen Millennium. In: Münsteraner Diskussionspapiere zum Nonprofit-Sektor, (10). Online verfügbar unter https://nbnresolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-373813, zuletzt geprüft am 10.07.2025.
Schubert, Peter; Kuhn, David; Tahmaz, Birthe (2023): ZiviZ-Survey 2023. Zivilgesellschaftliche Organisationen im Wandel – Gestaltungspotenziale erkennen. Resilienz und Vielfalt stärken. Hg. v. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V. Essen.
Simić Žana; Predov; Fiona (2014): Managerialismus und Hybridisierung von NPOs – Veränderungen und Folgen. In: Annette E. Zimmer und Ruth Simsa (Hg.): Forschung zu Zivilgesellschaft, NPOs und Engagement. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 357–369.