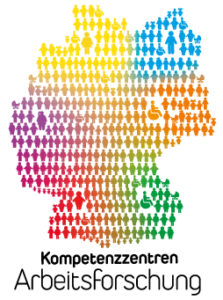Als Kompetenzzentrum möchten wir zukünftig einen tieferen Einblick in unsere Projektarbeit und die Menschen dahinter geben. Dafür werden wir in einer Interviewreihe unsere Mitarbeitenden vorstellen und ihre Aufgaben, Herausforderungen und Ziele näher beleuchten.
Das nachfolgende Interview haben wir mit Julia Friedrich geführt, die im Projekt ReOrga:Schulträger arbeitet. Im Interview beantwortet sie verschiedene Fragen rund um ihre Person und das Projekt. Lesen Sie weiter, um mehr über Julias’ Arbeit und die Ziele des Projektes zu erfahren.
Wer bist du und was machst du am KMI?
Mein Name ist Julia Friedrich, ich bin Arbeitsgruppenleiterin am Kompetenzzentrum KMI. Ich bin inzwischen seit mehr als zwölf Jahren am Institut und befasse mich in meiner Forschung mit Digitalisierungsprozessen, deren Gestaltung und Auswirkungen. Ich habe einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund und blicke deshalb nicht aus einer rein technologischen Perspektive auf Digitalisierungsprozesse. Digitalisierung ist nur ein Schritt in im fortlaufenden Prozess digitaler Transformation, welche das ganze Unternehmen bzw. die Organisation betrifft. Durch neue Technologie verändern sich Prozesse, verschwinden Aufgaben während neue hinzukommen. Es handelt sich also um einen stetigen Prozess der Organisationsentwicklung. Dabei geht es zumeist um die Frage der menschzentrierten Gestaltung von Arbeitsprozessen, die Entwicklung und Umsetzung von Digital-/ bzw. KI-Strategien sowie ethische und soziale Implikationen von Technologien – von der Auswahl über die Einführung bis zur Etablierung. Mir ist es sehr wichtig, diese erweiterte analytische Perspektive in die angewandte Informatik einzubringen. Natürlich geht es bei der Einführung von Software und der Digitalisierung oder Automatisierung von Prozessen um Effizienzsteigerung und die Frage, welche neuen Geschäftsprozesse sich durch innovative Technologien ergeben können. Dies allein darf aber nicht im Fokus stehen. Im Sinne der Nachhaltigkeit müssen neben ökonomischen Aspekten auch soziale und ökologische Auswirkungen der technologischen Neugestaltung von Prozessen in den Blick genommen werden.
In meinen Projekten habe ich in den vergangenen Jahren mit unterschiedlichsten Organisationen und Branchen zusammengearbeitet, von der Landwirtschaft über die Musikwirtschaft bis hin zur Automobilbranche. Wir haben mit Verwaltungsapparaten, mit Bildungsträgern, Pflegeeinrichtungen und Großunternehmen im produzierenden Gewerbe zusammengearbeitet. Diesen vielfältigen Blick auf die digitale Transformation empfinde ich als absolut bereichernd und freue mich, mit den Praxispartnern immer wieder neue, auf die individuellen Bedarfe der Organisationen zugeschnittene Strategien, Methoden und Herangehensweisen zu entwickeln. Dies ermöglicht es mir, digitale Transformation aus einem sehr breiten Blickwinkel heraus zu erforschen.
Die Erkenntnisse, die ich dabei gewinne, lasse ich auch in mein Promotionsvorhaben einfließen. Dabei geht es mir um die Frage, welche Rolle Werte in der digitalen Transformation, etwa in Digital- und KI-Strategien, aber auch bei der Technologieauswahl und -einführung, in gemeinwohlorientierten Organisationen spielen.
Was zeichnet die Arbeit am KMI/ im Projekt für dich aus? Was gefällt dir daran?
Die Arbeit am KMI ist geprägt von Interdisziplinarität. Meine Kolleg*innen haben ganz verschiedene wissenschaftliche Hintergründe, was unsere Arbeit sehr bereichert. Sowohl methodisch als auch inhaltlich sind wir dadurch breit aufgestellt. Die Tatsache, dass wir sehr lösungsorientiert arbeiten und uns alle gleichermaßen für unsere Arbeit begeistern, uns alle miteinander, ungeachtet von Berufserfahrung oder Titeln offen austauschen und stets auch konstruktiv kritisieren können, trägt für mich entscheidend zum Erfolg des KMI bei.
Im Projekt ReOrga:Schulträger haben wir uns erneut in einen Bereich vorgewagt, mit dem wir bisher keine größeren Berührungspunkte hatten. Das liegt nicht unbedingt nur an uns, sondern an der Tatsache, dass Schulträger und ihre Organisationsentwicklung generell bisher eine untergeordnete Rolle in der Forschung gespielt haben und maximal als Randnotiz aufgetaucht sind (mit Ausnahme der Arbeit des Forum Bildung Digitalisierung). Im Projekt schauen meine Kollegin Marina Torgovnik und ich uns an, wie sich Schulträger in ihrer Struktur, ihren Zuständigkeiten und ihrer Selbstorganisation im Kontext der zunehmenden Digitalisierung der Bildungslandschaft verändern (müssen). Bei all der (teils durchaus berechtigten) Kritik sowohl an der deutschen Bildungslandschaft als auch an Verwaltungsstrukturen generell halte ich es für sehr wichtig, einen holistischen Ansatz zu verfolgen und Strukturen, Ressourcen und Prozesse zu analysieren. Das ReOrga-Projekt verfolgt hierbei einen Ansatz, der den Wissenstransfer weit in den Vordergrund stellt. Unsere insgesamt acht Partner-Schulträger fungieren im Projekt als Multiplikatoren. Das bedeutet, dass sie die Learnings, die sie in der Vergangenheit gemacht haben und die sie aus der individuellen Organisationsberatung und den von uns gestalteten Angeboten wie Netzwerktreffen mitgenommen haben, weitertragen an Schulträger aus ihrer Region. Dank unserer bestens vernetzten Partner, dem Bündnis für Bildung e. V., Klett Mex GmbH und dem Forschungsinstitut Bildung Digital (FoBid) an der Universität des Saarlandes, können wir sicherstellen, dass unsere Forschungserkenntnisse zeitnah und praxistauglich bei den Schulträgern des Landes ankommen.
Welche Meilensteine hast du dieses Jahr schon erreicht?
Seit dem Start des Projektes im Dezember des letzten Jahres haben Marina und ich 17 Interviews mit Vertreter*innen unserer ersten vier Partnerschulträger geführt – eine echte Mammutaufgabe. Aktuell sitzen wir noch an der Auswertung, die sowohl in die individuelle Organisationsberatung als auch in unsere Publikationstätigkeit einfließen wird. Die Erhebung und Analyse des IST-Zustandes ist sehr spannend.
Zudem konnten wir im Konsortium eine erste Präsenzveranstaltung durchführen, an welcher Vertreter*innen aller Schulträger sowie unsere Projektbeiräte teilgenommen haben und auch das digitale Format der Netzwerktreffen haben wir angestoßen und erstmalig durchgeführt.
Warum erachtest du das Projekt als besonders relevant? Welche neuen Erkenntnisse konnten im Rahmen des Projekts gewonnen werden?
Die digitale Transformation ist ein Buzzword, hinter dem sich eine riesige Bandbreite an Veränderungsprozessen verbirgt, die es strukturiert und zielgerichtet zu bearbeiten gilt. Für viele Schulträger haben sich durch die fortschreitende digitale Transformation der Gesellschaft, insbesondere aber im Zuge der Corona-Pandemie und mit dem Digitalpakt 1 Aufgaben, Arbeitsinhalte und -volumen (etwa im Management der IT-Infrastruktur) verändert. Die Ausstattung der Schulen mit digitalen Endgeräten und der flächendeckende Aufbau und Betrieb einer digitalen Infrastruktur sind eine große Herausforderung. Die Geschwindigkeit, mit der Schulen digital ausgestattet wurden, wird zwar anerkannt, die organisationalen Prozesse, die in diesem Kontext bei den Schulträgern angestoßen wurden und die nicht alle reibungslos liefen, blieben bisher aber weitestgehend unbeachtet. Um auch in Zukunft digital-gestützten Unterricht zuverlässig und flächendeckend zu ermöglichen und auch den Einsatz von OER (Open Education Resources), also digital frei zugänglicher Lehr- und Lernmaterialien, weiter zu fördern, müssen Schulträger (in ihrer Rolle als Unterstützer und Ermöglicher der Digitalisierung an Schulen) gestärkt werden. Mit unserem vergleichenden und auf Networking basierenden Ansatz können wir hierzu entscheidend beitragen.
Das Projekt „ReOrga:Schulträger“ wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und gemeinsam von dem Bündnis für Bildung, der Klett MEX GmbH, dem Forschungsinstitut Bildung Digital an der Universität des Saarlandes (FoBiD) sowie dem Institut für Angewandte Informatik (InfAI) e. V. umgesetzt.